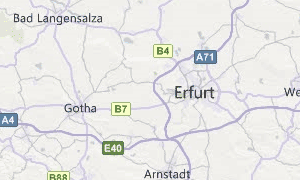Die Fabrik
Die Fabrik, „der Arbeitsplatz der Hundertzwanzig bis Hundertfünfzig, die hier ihr Tagewerk verrichteten, kahl, öde, schwarz, ohne eine Bequemlichkeit, durchtost von einem nie abbrechenden nervenzerreißenden Geräusch grell zusammenklingender Töne“, heißt es bei Paul Göhre.
„Und doch lag über dem allen auch Adel und Poesie. Nicht nur, wenn von oben das Sonnenlicht hereinflutete und selbst den Schmutz und das Eisen verklärte, sondern auch wenn ein grauer Himmel das Kahle, Öde, Schwarze noch kahler, öder, schwärzer erscheinen ließ. Das war die Poesie eines grandiosen ineinander greifenden Betriebes […] der Adel menschlicher Arbeit, die hier an einer einzigen Stelle von mehr als hundert Menschen im Kampfe ums Brot, um Leben und Genuß tagaus tagein gethan wird.“
Göhres intensive Beschreibung findet sich in „Drei Monate Fabrikarbeiter und Handwerksbursche“, seiner 1891 erschienenen Sozialreportage über seine Zeit in der Maschinenfabrik Kappel. Der evangelische Theologe schuftete im Chemnitzer Werkzeugbau, teilnehmend-beobachtend: „Einer meinte, an mir wäre ein Pastor verloren, ein andrer hielt mich für einen heruntergekommenen Studenten, ein dritter machte mir Aussicht, einmal Reichstagsabgeordneter zu werden.“ Letzterer sollte recht behalten – Paul Göhre trat, nicht zuletzt aus Protest gegen seine an sozialen Fragen kaum interessierte Kirche, 1900 in die SPD ein und saß über acht Jahre im Deutschen Reichstag. Die von ihm beschriebene Fabrik in Chemnitz, dem sogenannten Manchester Sachsens, war längst keine der frühindustriellen „dark satanic mills“, kein „Industriegefängnis“ mehr. Bei Göhre scheint hervor, was später die Wahrnehmung von Fabriken auch als „Kathedralen der Arbeit“, als „Industrieschlösser“ bestimmen sollte. Freilich waren die im 19. Jahrhundert entstehenden Fabriken einerseits Stätten der Entmündigung der Handwerker, deren Handarbeit durch Kraft- und Arbeitsmaschinen ersetzt und die in die Monotonie der Arbeitsteilung sowie die (Selbst-)Disziplinierung per Fabrikordnung gezwungen wurden. Andererseits, die „Fabrik bleibt lange Zeit trotz allem eine Welt, in der sich die Freiheit der Arbeiter artikuliert, dies umso mehr, als es gerade das Ziel der Fabrik ist, diese Freiheit einzudämmen […]. Wenn die Vorschriften immer zahlreicher werden, dann deswegen, weil man sie kaum beachtet“, so die Historiker Yves Lequin und Sylvie Schweitzer: Freiheit meint zugleich „Befreiung aus der familiären Zwangsjacke, von der Autorität des Vaters, aus der allzu strengen Überwachung durch den Besitzer des kleinen Handwerksbetriebs“. Arbeit und Identität verwoben sich mehr und mehr, worauf auch das sich wandelnde Verhalten von streikenden Arbeitern hindeutete: Im Laufe des 20. Jahrhunderts bestreikten sie immer häufiger Arbeitsinstrument und -platz, indem sie ‚ihre‘ Fabrik physisch besetzten, während viele Arbeitskämpfe zuvor noch aus der Stadt, der Fabrik, der Gegenwart hinausgeführt hatten an Stätten der Freizeit, ins Wohnviertel oder gar aufs Land, symbolisch also auch in vergangene Arbeits- und Lebenswelten. Endgültig zu identitätsstiftenden Orten, zu „Erinnerungsorten“ der Arbeiterschaft avancierten Fabriken seit den 1970er Jahren, als sie geschlossen und stillgelegt wurden – ohne die Unterstützung entlassener, ‚identitätssuchender‘ Fabrikarbeiter hätte wohl keine Bürgerinitiative, kein Geschichtsverein eine „Kathedrale der Arbeit“ vor dem Abriss retten können.