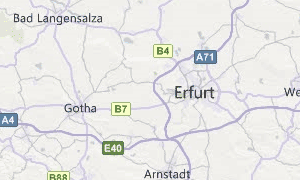Zwangsvereinigung
Die Zwangsvereinigung von KPD und SPD erfolgte 1945/46 als inszenierte Massenbewegung. Auf massiven Druck der sowjetischen Besatzungsmacht und befördert durch führende deutsche Kommunisten fusionierten die beiden ungleichen Arbeiterparteien am 21./22. April 1946 auf einem Parteitag im Berliner Admiralspalast zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED).
Vorausgegangen waren zahlreiche Vereinigungsbeschlüsse auf Orts-, Kreis- und Landesebene. Die im Kampf um organisatorische Eigenständigkeit in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) unterlegenen Sozialdemokraten flüchteten sich in politische Inaktivität, manche verbrannten sogar ihre Parteibücher. Andere versuchten, sozialdemokratische Positionen unter den neuen Verhältnissen durchzusetzen und Kontakt zu der von Kurt Schumacher geführten SPD in den Westzonen zu halten. Doch nicht alle Sozialdemokraten lehnten die Gründung der SED ab. Insbesondere diejenigen, die gemeinsam mit KPD-Funktionären in nationalsozialistischen Zuchthäusern und Konzentrationslagern gesessen hatten, machten sich für eine geeinte und damit schlagkräftige Arbeiterpartei stark. Ähnlich argumentierten junge Mitglieder, die erst nach 1945 zur Sozialdemokratie beziehungsweise zu den Kommunisten gefunden und die ideologischen Grabenkämpfe während der Weimarer Republik nicht miterlebt hatten.
Während die SED zur Kaderpartei „neuen Typus“ umgeformt und in der DDR vornehmlich in Gründungsjubiläumsjahren als ruhmreiche Errungenschaft der Arbeiterklasse glorifiziert wurde, schlug ihr aus der Bundesrepublik Deutschland scharfe Kritik entgegen. Noch 20 Jahre später, so hieß es 1966 in dem in Bonn erscheinenden Sozialdemokratischen Pressedienst, sei die Zwangsvereinigung nicht Geschichte, sondern unmittelbare Gegenwart und die SED eine mit List und Betrug, Terror und Grausamkeit ins Leben gerufene Partei. Dieser Tenor veränderte sich auch in den folgenden Jahrzehnten nicht. Vor allem das Einknicken von Otto Grotewohl, dem unter sowjetischem Druck stehenden Vorsitzenden des ostdeutschen SPD-Zentralausschusses, und sein symbolischer Händedruck mit dem KPD-Vorsitzenden Wilhelm Pieck zur Besiegelung der SED-Gründung wurden immer wieder in Erinnerung gerufen. Überaus positive Würdigungen erfuhr demgegenüber die am 31. März 1946 durchgeführte Urabstimmung der Sozialdemokraten in Westberlin, die sich klar gegen eine sofortige Vereinigung mit den Kommunisten ausgesprochen hatten.
Zum 40. Jahrestag der Zwangsvereinigung 1986 verdichtete sich das Gedenken. Offenbar rückte die SPD nun historische Themen in den Vordergrund, womöglich als Gegengewicht zur kohlschen Geschichtspolitik. Als Konsequenz der Neuen Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr wurde nicht mehr nur der repressive Charakter der SED-Herrschaft betont, sondern die friedliche Koexistenz der beiden deutschen Staaten hervorgehoben.
Nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der DDR veränderte sich die Erinnerungskonkurrenz. Die PDS als Nachfolgepartei der SED bemühte sich frühzeitig, nämlich bereits im Jahr 1990, die Vereinigung von KPD und SPD als freiwilligen Prozess darzustellen, konnte die Stalinisierung und das Scheitern der Kaderpartei jedoch nicht gänzlich verhehlen. Grundsätzlich zeigte die Öffnung der ostdeutschen Archive neue Forschungsperspektiven und Interpretationslinien auf. Als sich der Jahrestag der Zwangsvereinigung zum 50. Mal jährte, zog der SPD-Vorstand eine Linie von der 1946 in der Sowjetischen Besatzungszone unterdrückten SPD bis zur Gründung der Sozialdemokratischen Partei (SDP) in der DDR am 7. Oktober 1989 in Schwante. Zudem gab er in hoher Auflage historische Dokumentationen heraus, unter anderem eine fünfbändige Darstellung der Zwangsvereinigung auf Länderebene. Diese Texte, so lässt sich mutmaßen, sollten zum einen der innerparteilichen Selbstvergewisserung dienen. Zum anderen waren sie zur historisch-politischen Aufklärung der Bevölkerung in Ostdeutschland gedacht. Im Gegensatz zu diesem Erinnerungsboom fielen die Gedenkveranstaltungen 2006 weitaus kleiner aus. Mehr als eineinhalb Jahrzehnte nach der Deutschen Einheit kam anderen gesellschaftlichen Themen- und Problemstellungen höhere Priorität zu.



![… erinnert an den „Widerstan[d] gegen die neue Tyrannei“…<br> Bildrechte: AdsD … erinnert an den „Widerstan[d] gegen die neue Tyrannei“…<br> Bildrechte: AdsD](https://erinnerungsorte.fes.de/wp-content/gallery/zwangsvereinigung/thumbs/thumbs_3_00635903.jpg)